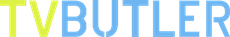"Man greift nach jedem Strohhalm"
 Worüber werden Sie bei "Wo ist mein Kind?" sprechen?
Worüber werden Sie bei "Wo ist mein Kind?" sprechen?
Ich werde versuchen zu erklären, wie mein Gefühlszustand während Nataschas Verschwinden war, was mir Hoffnung und Trost gegeben hat und natürlich auch, wie ich mit meiner Verzweiflung umgegangen bin. Anfangs war es ein einziges Auf und Ab der Gefühle: Zunächst habe ich mich zu Hause total verbarrikadiert, von der Außenwelt komplett isoliert. Dann kam das andere Extrem und ich wollte nur noch draußen sein. Den direkten Kontakt zu Menschen habe ich immer gescheut. Gefragt zu werden, wie es mir geht, wollte ich nicht. Die ganze Zeit über hat mich eigentlich nur eine Frage beschäftigt: Wo soll ich mein Kind suchen? In der Sendung möchte ich erzählen, wie man sich zwingen muss, am normalen Leben wieder teilzunehmen und seine Arbeit wieder aufzunehmen. Ein weiteres Thema habe ich mir vorgenommen: Wie machtlos ist man als Betroffener? Und wie begleitet einen diese schlimme Zeit dann immer weiter? Zum Beispiel passiert es mir heute noch, dass ich im Wohnzimmer direkt neben dem Telefon einschlafe - genau wie ich es während der Suche nach Natascha getan habe.
Was empfinden Sie, wenn Sie am 30. März andere Familien im "XY"-Spezial erleben?
Ich empfinde großes Mitleid für diese Familien und würde ihnen gerne helfen, wenn die Möglichkeit bestünde. Wenn einem so etwas widerfährt, denkt man nur: Wieso passiert ausgerechnet mir so etwas? Es klingt komisch, aber als ich von anderen schrecklichen Fällen aus den Medien gehört hatte, fühlte ich mich plötzlich nicht mehr so alleine mit meinem Schicksal.
Haben Sie einen Rat und Trost für die Angehörigen?
Ich möchte den Angehörigen gerne einen Hoffnungsschimmer geben, gerade weil es bei mir, wenn auch erst nach so langer Zeit, ein gutes Ende genommen hat. Es gibt leider keinen Leitfaden, wie man am besten mit solch einer schlimmen Situation umgehen sollte - jeder reagiert und verhält sich anders. Manche sind schnell nach dem schrecklichen Geschehen wieder arbeits- und gesellschaftsfähig, aber für mich war das undenkbar. Ich war total ausgeschaltet und für nichts zu gebrauchen.
Wie haben Sie den permanenten Schwebezustand erlebt: Lebt mein Kind noch oder nicht?
Ich bin davon überzeugt, dass eine Mutter spürt, wenn ihr Kind stirbt. Ich hatte kein Gefühl in dieser Richtung - das war ein Zeichen für mich, dass Natascha lebt. Trotzdem stand ich permanent unter Hochspannung. Wenn das Telefon läutete, hatte ich sofort Panik: Bekomme ich jetzt die schlimme Nachricht? Es gab nur ein Ritual, das mich etwas beruhigt hat, nämlich wenn ich mir Nataschas Bild ansah und mit ihr gesprochen habe: "Du bist stark", "Du schaffst das schon" und "Lass Dir nichts gefallen". Sobald jedoch in den Medien etwas erschienen war, das auf ein schlimmes Ende hindeutete, bin ich erneut in ein tiefes Loch gefallen. Genauso ging es mir, wenn die Polizei vor der Tür stand, um sich von mir gefundene Gegenstände wie Taschen oder Schuhe identifizieren zu lassen - da kam es mir vor, als ginge ich zu meiner eigenen Hinrichtung. Und wenn sich die schlimmen Befürchtungen dann hinterher nicht bewahrheiteten, fiel mir immer ein riesengroßer Stein vom Herzen.
Waren Sie damals überhaupt fähig zu arbeiten?
Glücklicherweise hatte ich einen Job, in dem ich mich frei bewegen konnte und nicht in einem Büro eingesperrt war: Ich habe für eine soziale Einrichtung gearbeitet, habe dafür ältere Menschen zu Hause besucht. Das war eine gute Ablenkung für mich.
Viele Eltern starten aus ihrer Hilflosigkeit heraus Eigenaktionen. Ist das klug?
Jede Aktion, die dabei helfen könnte, sein Kind zu finden, sollte nicht unversucht bleiben. Sonst gibt man ja innerlich auf. Für mich hat mein Kind gelebt, auch wenn mich im engsten Verwandten- und Bekanntenkreis bereits alle für unrealistisch gehalten haben.
Leider werden ja auch viele vermisste Kinder nur noch tot aufgefunden. Wie haben Sie es geschafft, trotzdem die Hoffnung nicht aufzugeben?
Man greift nach jedem Strohhalm. Ich habe mir sogar Trost und Beistand bei einer Astrologin geholt, mit der ich heute noch befreundet bin. Sie hat mir Hoffnung gegeben, dass mein Kind noch lebt und mich darin mental bestärkt. Sie war es auch, die sehen konnte, dass sie in einem "weißen Haus" lebt. Daraus entwickelte sich der Hoffnungsschimmer für mich, dass Natascha bei einer anderen Familie lebt, die selbst keine eigenen Kinder haben konnte.
Hatte sich bei Ihnen nicht mit den Jahren eine psychologische Schutzmauer des Verdrängens aufgebaut, um überhaupt weiterleben zu können?
Gelebt habe ich nicht in dieser Zeit, ich habe nur funktioniert. Meine Eltern haben mich gebraucht, vor allem meine Mutter, nachdem mein Vater gestorben war. Zu Hause konnte ich mich dann so gut wie nicht mehr aufhalten, denn dort ist mir die Decke auf den Kopf gefallen.
Wird man allmählich einsam mit diesem Schicksal?
Einige Bekannte oder Freunde haben sich von mir abgewandt und aufgrund ihrer Unsicherheit eine Begegnung vermieden. Ich konnte es gut nachvollziehen und damit umgehen. Denn als Außenstehender weiß man ja wirklich nicht, wie man mit dieser Situation umgehen soll.
Wollten Außenstehende nach einiger Zeit nichts mehr von Ihrem Leid hören?
In meinem Fall wurde ich regelrecht von allen Seiten belagert. Ich habe mich immer zurückgehalten und wollte keinem zur Last fallen. Wenn Leute allerdings Bemerkungen gemacht haben wie "Vielleicht ist es besser, dass sie tot ist, wenn sie etwas Schlimmes durchlebt hat", dann habe ich den Kontakt zu denen abgebrochen. Die meisten Menschen haben mir jedoch Trost gespendet und versucht, mich aufzurichten - dafür bin ich ihnen sehr dankbar.
Wer oder was hat Sie getröstet?
Anfangs erhielt ich keine Art von Unterstützung. Erst nach zwei Jahren hat sich eine Organisation bei mir gemeldet, die mir dann auch meinen heutigen Therapeuten empfohlen hat. Bei ihm kann ich mir ohne Scham alles frei von der Seele reden. Ich empfehle allen Betroffenen, sich bei einer Einrichtung Hilfe zu holen. Man erhält auch Unterstützung bei Amtsgängen und bei dem nervigen Schriftverkehr mit den Behörden. Ein Arzt hat Schweigepflicht, und man fühlt sich dort gut aufgehoben. Auch meine Astrologin hat mir sehr viel Kraft und Mut gegeben.
Wie geht es Ihnen heute?
Heute würde ich nie wieder einem Kind Ratschläge geben, wie ich es Natascha vor ihrem Verschwinden gegeben habe: "Man darf sich nach einem Streit nicht im Bösen trennen" oder "Eine Mutter weiß und sieht alles". Denn meine Tochter glaubte in ihrer Gefangenschaft immer fest an diese Worte und war umso trauriger, als ich sie dann nicht gefunden und befreit habe. Als wir wieder vereint waren, habe ich meine Zeit nur meinem Kind gewidmet und meine Arbeit niedergelegt. So komisch das klingt, aber Natascha wieder bei mir zu haben, war manchmal härter für mich als die Zeit, in der sie verschwunden war. Aus ihrem Mund über die grausamen Geschehnisse zu erfahren, war die reinste Hölle. Die ganze Wahrheit belastet mich bis heute noch viel zu sehr, um ihr Buch zu lesen. Das schaffe ich noch immer nicht. So genau will ich es jetzt auch nicht mehr wissen, sonst falle ich wieder in ein Loch. Die Wahrheit ist einfach zu belastend und schmerzhaft. Ich habe mein Leben so ausgerichtet, dass ich Natascha jederzeit helfen und sie unterstützen kann. Im ersten Moment denkt man auch an Vergeltung, aber nach einer gewissen Zeit siegt die Vernunft, und man blickt nach vorne.
Das Interview führte Gordana Zezelj